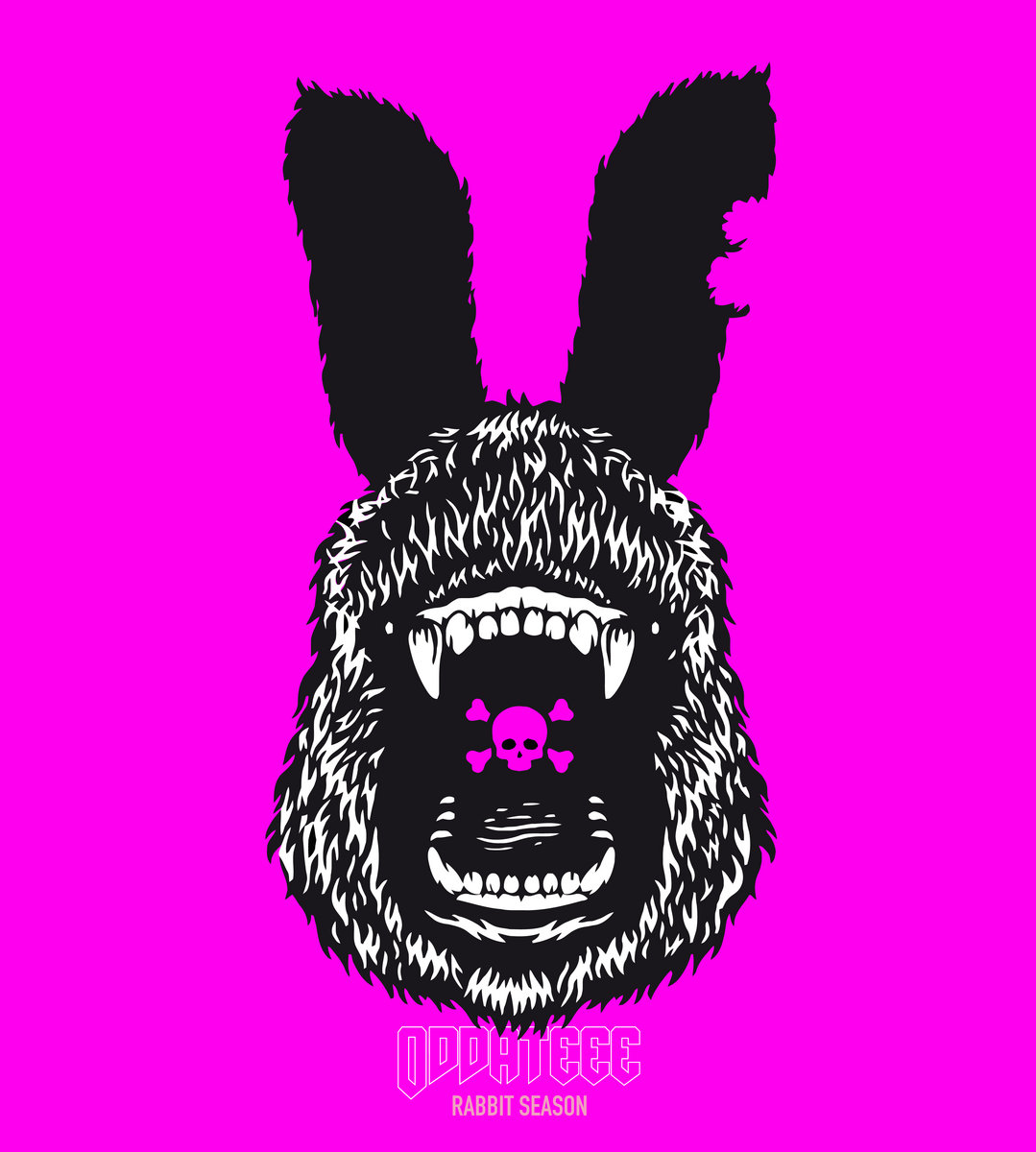Bär(t)ige Bekenner
Musik als Eigen-Therapie: Neue Platten von John Grant und Mark Oliver Everett alias Eels.

Der Zug der Endlichkeit: Mark Oliver Everett. © Gus Black
Live-Aid-Initiator Bob Geldof hat einmal, in jenen fast schon unerinnerlichen Zeiten, in denen er noch als Musiker bekannt war, über seinen Kollegen Sting gesagt, jedesmal, wenn der ein Buch gelesen habe, mache er gleich eine LP darüber.
Für Mark Oliver Everett scheint zu gelten: Jedesmal, wenn E, wie er gemeinhin firmiert, sich einigermaßen ernsthaft verliebt hat, kommt ein Album. Erst recht über die anschließende Trennung. Im aktuellen Fall ist der Auslöser allerdings eine überstandene Herzoperation – sowas gebiert Nachdenklichkeiten über die Endlichkeit des Lebens.
Keine Frage, der heute 61-jährige, in Virginia geborene, aber seit ewig und drei Tagen in Kalifornien ansässige Everett hat definitiv viel zu erzählen. Seinen Vater, einen angesehenen, dem Alkohol verfallenen Wissenschafter, fand er tot im Bett, als er 19 war. Seine geliebte Schwester Elizabeth beging Suizid. Seine Mutter fiel einem Krebs zum Opfer. Eine seiner Cousinen war Flugbegleiterin in jener Maschine, die am 11. September 2001 in das Pentagon stürzte – und dabei genau jenen Trakt, in dem einst sein Vater gearbeitet hatte, in Schutt und Asche legte.
Großes Frühwerk
Seine problematische Kindheit und Adoleszenz verarbeitete der Sänger, Songschreiber und Mulitinstrumentalist mit seiner vorgeblichen Band Eels, die in realiter nichts anderes ist als er selbst mit wechselnden, wenn auch versierten Erfüllungsgehilfen, zu großartigen Platten: „Beautiful Freak“ (1996) über die Geburtsschmerzen der Künstler-Existenz, „Electro-Shock Blues“ über die Familientragödien (1998) und um die Jahrtausende das eher folkloristische „Daisies Of The Galaxy“, das anmutet, als würde jemand, noch außer Atem von gerade überstandenen Turbulenzen, versuchen, Luft zu holen.
Danach wurde es musikalisch diverser, bisweilen auch problematischer; mal ging die Reise Richtung Blues- und Hardrock, dann wieder Richtung Orchester- und Kammermusik, ein andermal kam mehr Elektronik ins Spiel. Heute weiß E all diese Einflüsse stilsicher mit seiner natürlichen Kernkompetenz als Liedermacher im Geiste großer Songwriter wie Bob Dylan, Neil Young, Daniel Johnston oder Joni Mitchell abzustimmen; kaum etwas schlägt störend aus – musikalisch funktionieren Eels-Platten seit vielen Jahren als gereifte Konglomerate der frühen Meisterwerke.
Ein gewisses Problem aber war ab einem gewissen Punkt, augenfällig allerspätestens Ende der Nuller-Jahre, die inhaltliche Ebene. Irgendwann produziert eine auf Dauerbetrieb gestellte Innensichtkamera nur mehr Leere oder banale Schablonen. Deswegen funktioniert notabene ja auch autobiographische „Literatur“ im Regelfall nicht.
Natürlich hat E seine Rettungsanker, um in der Introspektive nicht völlig auszurinnen. Zum einen ist er Existenzialist genug, um beim Zählen der Falten im Spiegel oder beim Händchenhalten mit der Geliebten nicht wenigstens aus den Augenwinkeln die grassierende gesellschaftliche Devastation zu bemerken.
Zum anderen ist da sein Witz, der schon bei vielen Anlässen zu Buche geschlagen hat. Vom Verlag um einen Kommentar zu Kurt Cobains Tagebüchern gebeten, lieferte er: „Bitte macht das nicht auch mit mir, wenn ich mich umbringe“ (wurde freilich nicht verwendet). Seine eigene, 2008 erschienene Autobiographie trägt den Titel „Things The Grandchildren Should Know“. Den Verlag zum Schutz seiner Urheberrechte nennt er (seit jeher) „Sexy Grandpa Music“ (an dieser Stelle empfiehlt sich die Erwähnung, dass E erst im Alter von 54 Jahren Vater wurde und das mit Opatum und Enkerln sich als recht unsichere Sache darstellt).
Auf dem neuen, musikalisch weitgehend zurückgenommenen, sporadisch indes wie unkontrolliert auszuckenden, in Songs wie dem formidablen „If I´m Gonna Go Anywhere“ auch psychedelisch beschlagseiteten Eels-Album „Eels Time!“ streift Everett an die Grenze zur Selbstverarschung an. Da behauptet er nämlich, das einzige Wesen, das er zu seinem Glück brauche, sei sein Goldfisch. „A lotta fish in the sea / But he’s sticking with me / A lotta fish in the sea / But he’s all that I need“ singt er da.
Wie die Zeit vergeht

Eels: Eels Time! (E Works/PIAS)
Die Zeit ist das Thema auf „Eels Time!“. Nicht dass, wie Everetts kämpferische Pose auf dem Cover und insbesondere der Titel, verstärkt durch das Rufzeichen, „die Zeit der Eels“ ausgerufen würde – vielmehr geht es um das unbarmherzige Wesen der vierten Dimension, die unser aller Leben abzählt: Wie ihr Vergehen subjektiv empfunden wird, wie sie Dinge und Wesen mit sich nimmt. Wie sie auch, siehe Goldfisch, den Blick auf das Wesentliche konzentriert.
Man wird dankbar für die guten Dinge, die man (noch) hat. Man verrichtet bestimmte Handlungen vielleicht zum letzten Mal, wird bestimmte Menschen nicht mehr sehen. Und Chancen, die man versemmelt hat, nicht mehr bekommen.
Das Solo-Werk als Biographie
John Grant ist nicht weniger autobiographisch als E. Man kann anhand der Platten, die er nach der Auflösung seiner respektierten, aber glücklosen Rock-, Folk- und in verträglichen Dosen Art-Rock-infiltrierten Formation The Czars veröffentlicht hat, sogar recht schlüssig seinen Lebensweg nachzeichnen.

Songs über Trump und die Eltern: John Grant. © Hoer ur Sveinsson
Wenn er sich bei den Czars von „Bright Black Eyes“ und ähnlich drogenvernebelten Wahnbildern verfolgt gefühlt hatte, so outete er sich 2010 auf seinem überraschend erfolgreichen, mit der Band Midlake eingespielten Solo-Debüt „Queen Of Denmark“ ausgenüchtert und entschlossen als schwuler Künstler.
Neue Düsternis durch eine HIV-Infektion verschattete „Pale Green Ghosts“ (2013); sein polyglotter Lebensstil wiederum prägte das internationalistische „Grey Tickles, Black Pressure“ (2015). Auf „The Boy From Michigan“ (2021) schließlich reflektierte Grant seine formativen Jahre im titelgebenden Staat im Norden der USA.
Indessen ist Grant, ein Sprachgenie, das Deutsch genauso perfekt kann wie Russisch und Isländisch und außerdem Spanisch, Französisch und Schwedisch in konversationsfähigem Ausmaß beherrscht, lyrisch ein ganz anderes Kaliber als E. Wenn er deutsch spricht, fällt nicht nur auf, wie gut, sondern vor allem wie pointiert er das kann. Dasselbe gilt auch für seine Texte, bei denen es einige Zeilen zu bereits legendärem Status gebracht haben: „I wanted to change the world / but couldn´t even change my underwear“.
Politisches mit Privaten vermischt
Und anders als Eels-Platten sind John Grants Werke nicht allein persönliche Bekenntnisse, sondern auch Dokumente unserer Zeit. Erzählen über Rechtspopulismus, Umweltzerstörung, den gesellschaftlichen Mainstream, Bigotterie, nicht zuletzt über Turbokapitalismus und Konkurrenzdruck, reflektiert mit Verweisen auf die Film-, Fernseh- und Popgeschichte, aber auch die uns prägende Populärkultur.

John Grant: The Art Of The Lie (Bella Union)
Auf gewisse Weise spiegelt sich Grants Lebensweg und -sicht sogar in seiner musikalischen Entwicklung. Denn seit der Sänger und Pianist in Island lebt – das sind immerhin schon 13 Jahre – , unterlegt ein „kalter“ Elektronik-Sound seinen gefühlvollen Bariton. Dieser Sound, mit dem er musikalisch eigentlich nicht sozialisiert worden ist, wird fallweise (wie auf Grey Tickles…“) durch Heavy Rock- und Pop-Beigaben bereichert/variiert, dann wieder wie bei „Love Is Magic“ (2018) in eher puristischer Form ausgegeben.
„The Art of the Lie“, dessen Titel eine genüssliche Anspielung auf Donald Trumps Buch „The Art Of The Deal“ zugrunde liegt, ist von Elektronik durchzogen und ruht gleichwohl auf einem soliden organischen Fundament.
Das Album beginnt mit einer Enttäuschung: Der Opener „All That School For Nothing“ ist für den Funk-Knaller und Dancefloorfeger, der er offensichtlich sein will, zu behäbig und bieder in Szene gesetzt. Dasselbe gilt für „It´s a Bitch“, das indes mehr noch unter den Comedy-Effekten leidet, wie sie Grant schon auf „Grey Tickles…“ und „Love Is Magic“ appliziert hat und die allesamt nichts gebracht haben.
Diese Dinger sind insofern ein wenig (sehr) ärgerlich, weil sie einen schönen, faszinierend ruhigen Fluss unterbrechen. Was für ein Album wäre „The Art Of The Lie“ geworden, hätte Produzent Ivor Guest (oder auch Grant selbst oder beide) den Mut und die Konsequenz gehabt, es im Zeitlupen-Tempo mit seinen schwebenden Synthis, fein austarierten Gitarreneinsätzen und subtilen Rhythmusakzenten durchlaufen zu lassen!
Inhaltlich lassen sich – siehe oben – zwei Tendenzen ausmachen: Politisches und Privates. Da ist zum einen eine weitere Breitseite gegen Donald Trump: „Jesus wants you rich“, legt Grant dem früheren und wohl auch künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten als Glaubensbekenntnis für seine Anhänger in den Mund.
Da ist zum anderen die Auseinandersetzung mit Grants Elternhaus. Ein sehr heikles Thema, da diese als strenge Methodisten seine Homosexualität nicht akzeptierten. Die drei Stücke, die sich mit ihnen beschäftigen, zeichnen indes ein differenzierteres Bild, als es die Biographien des Musikers meist übertragen. Geborgenheit wird da vermittelt, auch scheint dem Vater Humor nicht völlig fremd gewesen zu sein; auf der anderen Seite ist auch die Rede von einer Lebenslüge und einer Lebensangst, die sich auch auf ihn selbst übertragen hätte.
Mit der Auseinandersetzung ist auch schon die erste Stufe zur Überwindung erklommen. John Grant war schon immer sein eigener Therapeut.

Der Zug der Endlichkeit: Mark Oliver Everett. © Gus Black
Man wird dankbar für die guten Dinge, die man (noch) hat. Man verrichtet bestimmte Handlungen vielleicht zum letzten Mal, wird bestimmte Menschen nicht mehr sehen. Und Chancen, die man versemmelt hat, nicht mehr bekommen.