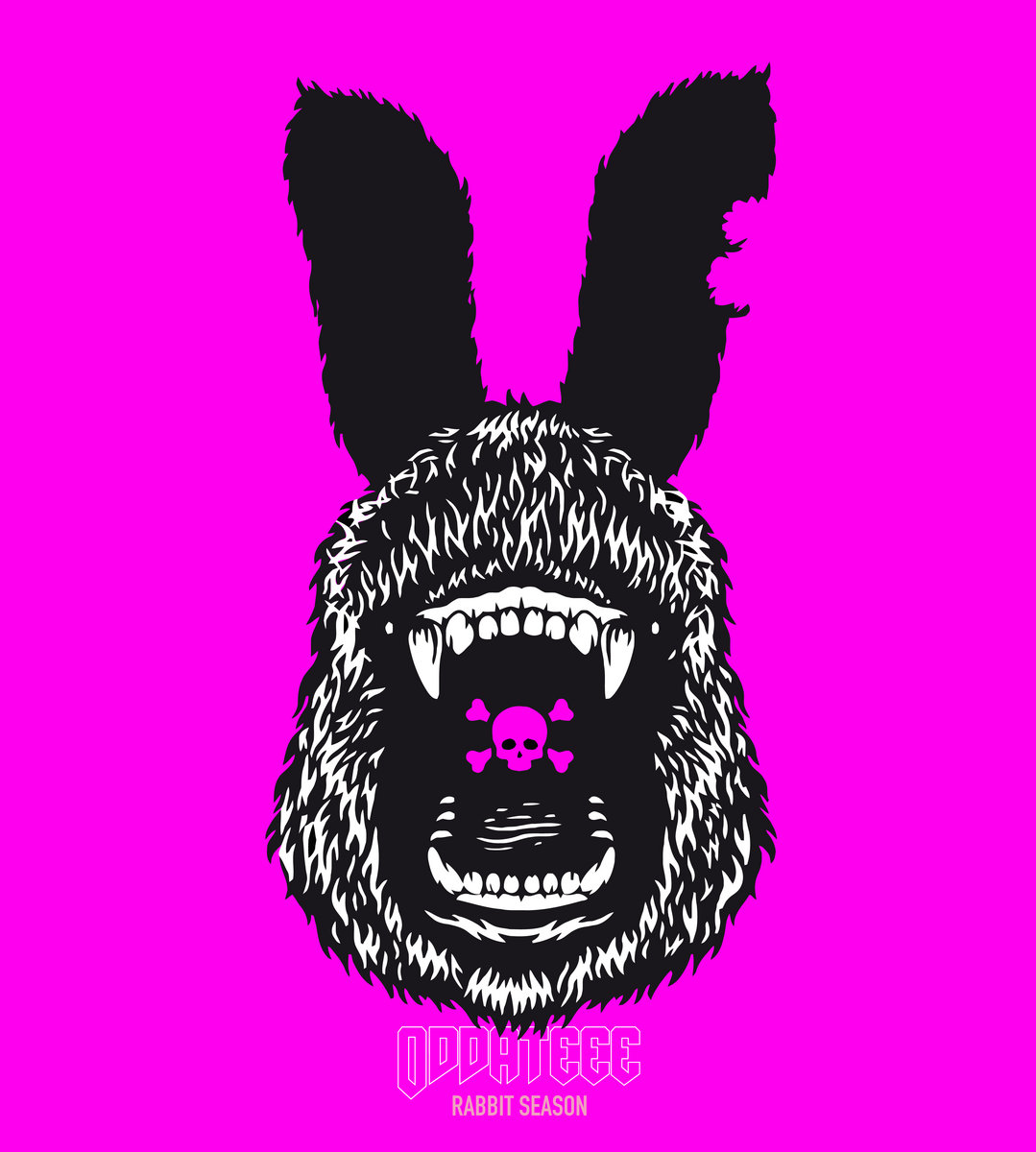Das Beste, das wir nicht gespielt haben (3)
Soul-Ikonen: Sinkane & Michael Kiwanuka. Orchestraler Pop mit The Last Dinner Party. Grandios eigenbrötlerisch wie immer: Isolation Berlin.

Newcomer-Hype des Jahres: The Last Dinner Party (© Wikpedia)
Zwei Ikonen des kontemporären Soul haben in diesem Jahr erstmals seit 2019 wieder von sich hören lassen. Sie haben auch andere Merkmale – biographischer, formaler und wesenhafter Natur – gemeinsam: Beide legen „Soul“ als Genre oder „Schwarze Musik“ als übergeordnete Kategorie recht großzügig aus; beide haben hohe Stimmen und sind Multinstrumentalisten mit Fokus auf die Gitarre, beide stammen aus Afrika ab, und beide sind in London geboren.
Ahmed Gallab, Jahrgang 1983, stammt aus dem Sudan, wohin seine Eltern nach seiner Geburt noch einmal kurz zurückkehrten, ehe sie in die USA übersiedelten, als er fünf Jahre alt war. In New York formierte er unter dem Moniker Sinkane eine lose Bandkonstellation, um Soul mit unterschiedlichen Idiomen vom klassischen R&B, der auf seinen frühen Platten ziemlich stark präsent ist, über New Wave, Funk bis zu Indie-Pop und – prominent dosiert auf dem letzten Sinkane-Album „Dépaysé“ – Rock zusammenzubringen.
Auf vielen der bis heute neun Sinkane-Platten setzt sich Gallab mit der eigenen Identität auseinander. Auf „Dépaysé“ tut er das, indem er seine Erfahrung der Diaspora, der Entwurzelung beschreibt – als US-Amerikaner sudanesischer Herkunft und Muslim, der sich von der Religion nicht das Leben diktieren lassen möchte.
„Freunde meiner Familie sagen, du bist kein echter Sudaner. In den Staaten sagen sie, du bist nicht wirklich ein Amerikaner. Schwarze sagen, du bist kein richtiger Schwarzer. Muslime sagen, du bist so seltsam, du kannst kein Muslim sein“, beschrieb er seine Existenz in einem Gespräch mit dem Autor für die „Wiener Zeitung“.
 Sinkanes heuer erschienene LP „We Belong“ (City Slang) bricht einerseits nicht mit dieser Geschichte der Selbsterforschung, geht dabei aber über das Ich hinaus. Das Thema ist nämlich Gallabs Herkunft – und zwar nicht seine familiäre, sondern seine kulturelle Herkunft. „We Belong“ ist ein lebendiger Tribut an die Geschichte der schwarzen Musik. Im Zugang also naturgemäß Barry Adamsons großem Werk „Cut To Black“ nicht unähnlich, bettet die Platte Gallabs immer noch berückendes Falsett mit Hilfe vieler Gastmusiker aus der Jazz-, Soul- und Gospelszene in wuchtige Bässe, scheppernde Drums, Soul-Streicher und opulente Hintergrund- und Begleitgesänge, um großen Wegbereitern und Inspirationsquellen wie Stevie Wonder, Sly And The Family Stone, George Clinton oder dem Disco-Sound der 70er und 80er Jahre Reverenz zu erweisen.
Sinkanes heuer erschienene LP „We Belong“ (City Slang) bricht einerseits nicht mit dieser Geschichte der Selbsterforschung, geht dabei aber über das Ich hinaus. Das Thema ist nämlich Gallabs Herkunft – und zwar nicht seine familiäre, sondern seine kulturelle Herkunft. „We Belong“ ist ein lebendiger Tribut an die Geschichte der schwarzen Musik. Im Zugang also naturgemäß Barry Adamsons großem Werk „Cut To Black“ nicht unähnlich, bettet die Platte Gallabs immer noch berückendes Falsett mit Hilfe vieler Gastmusiker aus der Jazz-, Soul- und Gospelszene in wuchtige Bässe, scheppernde Drums, Soul-Streicher und opulente Hintergrund- und Begleitgesänge, um großen Wegbereitern und Inspirationsquellen wie Stevie Wonder, Sly And The Family Stone, George Clinton oder dem Disco-Sound der 70er und 80er Jahre Reverenz zu erweisen.
Der LP-Titel wie auch einige Texte, die fast ausnahmslos von Gallabs langjähriger Weggefährtin Amanda Khiri mitgeschrieben worden sind, sind gleichermaßen emotionale wie selbstbewusste Hymnen an die Selbstermächtigung: Wir gehören dazu, wir sind Teil der Kulturgeschichte. Und ein wichtiger obendrein.
Psychedelischer Flow
Michael Kiwanuka ist fünf Jahre jünger als Ahmed Gallab, im angeblich multikulturellen London geblieben, doch die Probleme eines Menschen mit Migrationshintergrund waren lange Zeit auch die seinen: Die Sprache seiner ugandischen Eltern, die vor dem Diktator Idi Amin geflohen sind, versteht er nicht, und die Briten derstessen sich bei seinem Namen. Trotzdem hat er sich nie ein künstlerisches Alias zugelegt. Stattdessen hat er, justament, will es scheinen, sein drittes und bisher letztes Album „Kiwanuka“ genannt.
Nicht unerwähnt bleiben soll dabei, dass schon sein Erstling („Home Again“, 2012) vergoldet und und so wie dessen Nachfolger („Love & Hate“, 2016) für den Mercury Prize nominiert wurde. Bei „Kiwanuka“ schließlich blieb es nicht bei der Nominierung – es fuhr 2020 den begehrtesten britischen Musikpreis auch tatsächlich ein.
Mit „Kiwanuka“ vollzog der Künstler einen eher noch dezenten Schwenk Richtung Psychedelia. Der hat sich auf seinem heuer im Spätherbst veröffentlichten, wieder von Brian Burton (Danger Mouse) und Dean Josiah Cover (Inflo) produzierten vierten Album, „Small Changes“ (Polydor), zu einem zwar sanften, aber stetigen Flow verstärkt.
Im Opener „Floating Parade“ rührt ein munterer Bass die Oberfläche auf wie eine unterirdische Strömung ein vermeintlich ruhiges Wasser, während Hintergrundstimmen und eine dezente Gitarre Räucherstäbchenstimmung machen und Kiwanukas anheimelnde Stimme dem Hörer Bescheidenheit ans hoffentlich längst ergriffene Herz legt.
Dem folgt eine Kette melodiesatter psychedelischer Songs, die einmal mehr Richtung Soul, dann mehr Richtung Rock der 60er Jahre driften. Love oder die ganz frühen Cream scheinen hier für Momente aufzuerstehen und es ist gar nicht besonders verrückt, sich an einigen Stellen sogar an Jimi Hendrix erinnert zu fühlen: den Hendrix von Balladen wie „The Wind Cries Mary“ oder „Angel“, wo nicht so sehr wie sonst die Gitarre als mehr ein Stimmungszustand die musikalische Dramaturgie dominierte.
So wie Sinkanes „We Belong“ und auch die Vorgänger aus Kiwanukas eigenem Oeuvre ist „Small Changes“ keineswegs eine unkritische, eigenen Verfehlungen und globalen Problemen gegenüber blinde Platte – „Rebel Soul“ heißt ein Song sogar -, aber sie präferiert, wie der LP-Titel nachgerade programmatisch sagt, den Weg der kleinen Schritte gegenüber der aggressiven Agitation. Und appelliert an die Kräfte des Beharrens: „Follow your dreams like a lost child“.
Den Newcomer-Hype des Jahres hat das britische All-Female-Quintett The Last Dinner Party entfacht. Es ist eine wilde, eklektische Mischung, die auf ihrem Debüt-Album „Prelude To Ecstasy“ (Island) aufgefahren wird: ABBA im orchestralen Barock-Rock-Format, durchbrochen von spritzig-explosivem Glam-Rock à la (frühe) Sparks; inhaltlich gerahmt von Lebensgier, erotischem Verlangen und etwas existenzialistischer Tristesse, wie sie für die britische New Wave in den späten 70er Jahren charakteristisch war.
Das Komische – und eigentlich Unerklärliche – ist, dass sich das in der Summe tatsächlich ausgeht: Diese von überall her zusammengeklaute Musik fügt sich zu einem individuellen Ganzen, das im Wechselspiel mit den hoffnungslos überspannten Texten – einer übrigens ist, mit ziemlich sinistrer Anmutung, in Albanisch interpretiert – formidablen Drama-Pop ergibt.
Luxus des Ausuferns
Wenn die eine große deutsche Rock-Band der Gegenwart, nämlich International Music, eine Platte macht, darf die andere nicht zurückstehen: Auch Isolation Berlin sind heuer wieder mit einem neuen Album vorstellig geworden. „Electronic Babies“ heißt es und ist nicht mehr auf dem unabhängigen Label Staatsakt, sondern beim Industrieriesen Universal erscheinen. Ein musikalischer Fingerzeig ist das nicht – im Gegenteil: Das Quartett um den Dichter, Sänger und Texter Tobias Bamborschke nimmt sich mehr Freiheiten denn je zuvor.
Der musikalische Rahmen ist weit gespannt zwischen eingängigem, bisweilen fast ins Fahrwasser des Schlagers kommendem Pop, harschem, oft maschinell kanalisiertem Rock und romantischen Chansons – übrigens bisweilen verschönert durch die Trompete des Großmeisters dieser Spielart, sprich: Element-Of-Crime-Sänger Sven Regener.
Isolation Berlin leisten sich den Luxus des Ausuferns. Vieles zieht sich da mit einer Penetranz, die sich nichts scheißt und höchstens Hörer, die sich darüber ärgern, beschämt, in die Länge und Breite: Bis Ende nie ausgewalzte Refrains wie „Ich möchte echt sein“, wunderschöne, philosophisch durchtränkte Geschichten über gescheiterte Beziehungen und Alkoholiker, roboterhaft wiederholte Reizworte und -phrasen, virtuos gereimte Assoziationsketten: „Was uns beide zueinanderzieht / ist nicht Liebe / nein das ist Chemie / Neurobiologie.“
Das ist gleichermaßen verrückt wie intelligent realisiert und vergisst dabei nicht, in welchem Topos es spielt: Musik, die gerne gelesen werden will und dabei in jedem Moment die katalysatorische Unabdingbarkeit ihres ureigenen Wirkens zu unterstreichen weiß.

Newcomer-Hype des Jahres: The Last Dinner Party (© Wikpedia)