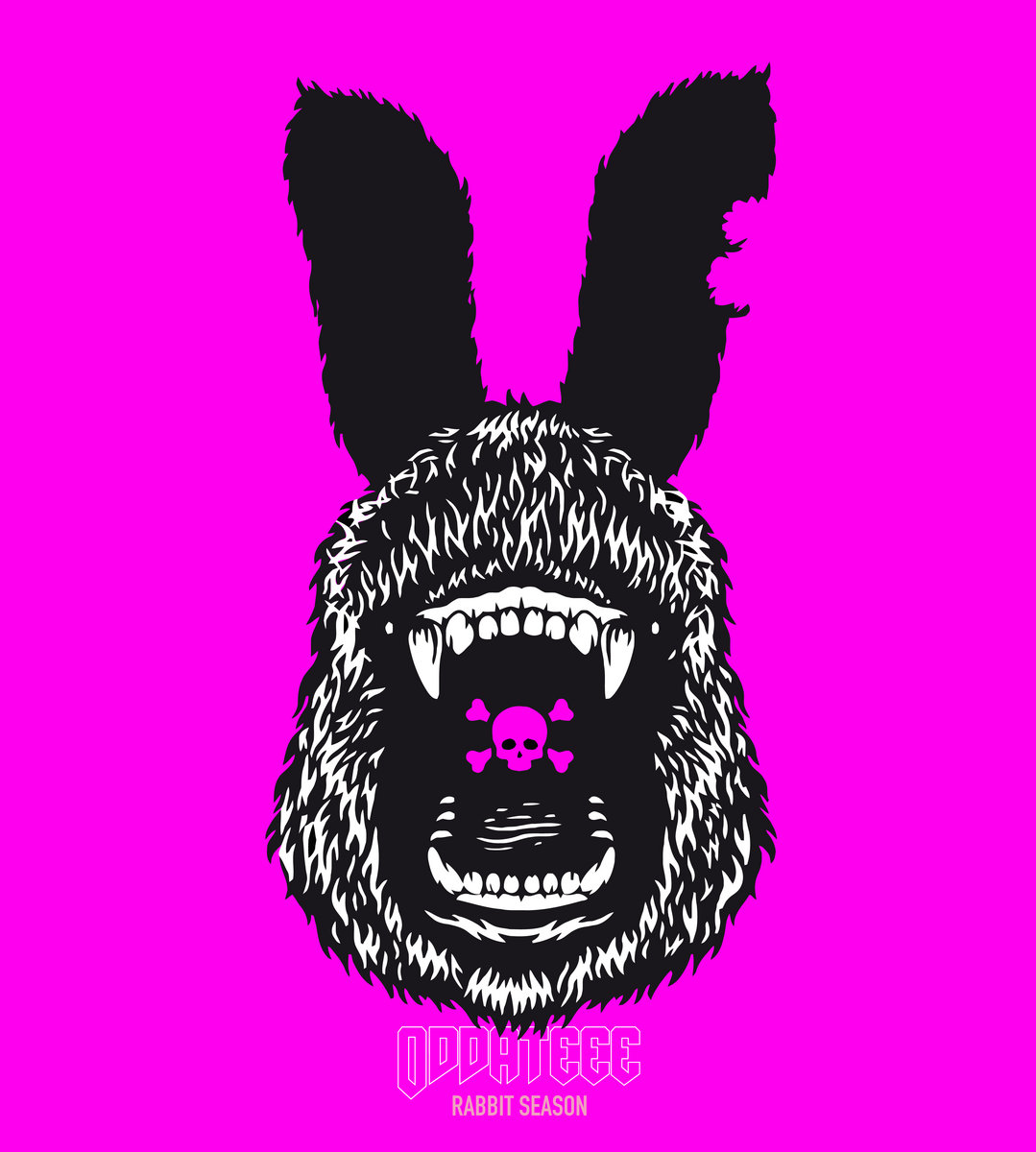Von halben Strecken und ganzen Wegen
Femininer Kunst-Pop und der hörbare Faktor Zeit: Zu den neuen Alben von St. Vincent und Beth Gibbons.

St. Vincent: All Born Screaming (Virgin)
Keine Frage, dass 2024 – so viel kann man nach den ersten viereinhalb Monaten wohl schon gesichert behaupten – ein feminines Popjahr ist und auch bleiben wird. Neben den Aufmerksamkeitskaiserinnen Beyoncé, Taylor Swift und Dua Lipa, die alleine schon rund zwei Drittel des weltweiten Streamingmarkts be-herr-schen (was böte sich hier als alternatives Verbum an?), haben auch im Kunst-Pop heuer bisher vor allem Frauen für herausragende & nachhaltige Momente gesorgt, wie etwa Julia Holter mit ihrem zwar sperrigen, dafür atmosphärisch dichten Album „Something In The Room She Moves“, aber auch US-Folkeuse Adrianne Lenker (mit „Bright Future“) oder Jessica Pratt („Here In The Pitch“). Und nun kommen mit den neuen Veröffentlichungen von St. Vincent und Beth Gibbons noch zwei Kaliber hinzu.
Über die 1982 als Annie Clark in Oklahoma geborene, seit 2006 als St. Vincent firmierende Sängerin und Multiinstrumentalistin ist viel gesagt & geschrieben worden, stets mit Hinweisen auf ihre chronische Wandelbarkeit und Maskenhaftigkeit garniert, und den Versuchen, hinter all dem so etwas wie einen persönlichen Kern auszumachen. Das ist auch nun, nach Erscheinen ihres siebenten vollen Albums (wenn man „Love This Giant“. die Kollaboration mit David Byrne aus 2012, nicht mitzählt), nicht anders.
Da die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Künstlerin einmal persönlich kennen lernen (um mancherlei Behauptungen zu überprüfen), verschwindend gering ist, braucht uns dieses eher nur pressetechnisch ergiebige Theater rund um die Mystifikationen und „wahren“ Persönlichkeitsanteile nicht weiter zu interessieren, dafür schon mehr die Frage, ob „All Born Screaming“ ein gutes Album geworden ist. Nach erstmaligem Anhören hätte ich diese Frage verneint, zu unstet, böllernd und überladen erschienen mir die zehn darauf enthaltenen Songs. Nunmehr, nach mehrmaligem Hören, neige ich zu einem differenzierteren und positiveren Urteil.
Rüder Anrempelsong
Mit „Hell Is Near“, dem Eröffnungsstück, beginnt das Ganze – trotz bedrohlicher Ankündigung und feuriger Anspielung am (Album-)Cover – erstaunlich stimmig & harmonisch, fast kammermusikalisch transparent instrumentiert und mit klimperndem Piano buchstäblich vorwärts tastend. Auf „Reckless“ wird es dann schon etwas harscher und (nach rund zwei Dritteln) ungemütlicher, während uns mit „Broken Man“ an dritter Stelle ein rüder Anrempelsong gezielt zwischen die Beine tritt: „Who the hell do you think I am? / And what are you lookin at? / Like you’ve never seen a broken man …“ Dave Grohl (Ex-Nirvana), zum Glück kein broken man, trommelt zum sirenenhaft-übersteuerten und mehr geschrienen als gesungenen Refrain einen harten, rumpeligen Takt.
In der Albummitte wird das Angebot thematisch breiter und stilistisch vielfältiger. Während „Big Time Nothing“ mit im Hallraum herumirrenden Funkfetzen und Gitarrenloops noch wie ein Plünderungszug durch den hinterlassenen Soundpark von Prince klingt, schwingt sich „Violent Times“ mit viel Blech und arienhaft-feierlichem Gesang zu einer aufgedonnerten James-Bond-Ballade empor. Und wenn man schon glaubt, dass mit dem zwar alarmistisch getexteten, aber vergleichsweise lieblich dargebrachten „The Power’s Out“ dem Album allmählich der Saft ausgeht („ The power’s out / And no one can save us / No cone can blame aus now …“), kommen mit „Sweetest Fruits“ und „So Many Planets“ noch zwei unerwartet vitale Popsongs mit funky, reggae-shuffelnden Elementen daher.
Erst danach wird mit dem gemeinsam mit Cate Le Bon musizierten, fast 7-minütig gewundenen Titelsong tatsächlich ein markanter Schlusspunkt gesetzt, für den nochmals gilt, was Andreas Rauschal bereits 2012 in der „Wiener Zeitung“ als St.Vincent-typische Mixtur erkannte: nämlich wie „grundschöne Melodien mit akustischem Sperrfeuer und ästhetisch harten Cuts zusammengehen“. Fazit: „All Born Screaming“, nicht nur die Nummer, sondern das gesamte Album (übrigens von Annie Clark durchgängig selbst produziert), hat unüberhörbare Ansätze von Größe, bleibt aber aufgrund allzu vieler Ambitionen und übertriebenem klang-materiellem Aufwand auf halbem bis dreiviertel Weg dorthin stecken.
10 Songs in 10 Jahren
Da ist Beth Gibbons mit „Lives Outgrown“ deutlich weiter vorangekommen. Aber gut, die ehemalige Portishead-Sängerin hat dafür auch zehn Jahre gebraucht. Denn so lange hat die buchstäbliche Verfertigung dieses Album gedauert, mit lediglich zehn Songs darauf (Taylor Swift könnte sich an solch ökonomischer Selbstbeschränkung künftig ein Beispiel nehmen!).

Beth Gibbons: Lives Outgrown (Domino)
2008 war das letzte Portishead-Album („Third“) erschienen, danach war von der (1965 in Exceter geborenen) Britin nur noch auf Kooperationen mit Rustin Man, Kendrick Lamar und vor allem in einer Aufnahme von Henryk Góreckis „Symphony Of Sorrowful Songs“ (2019) partiell zu hören gewesen. Nun also ihr erstes richtiges Solo-Album.
Langsamkeit war einer der bestimmenden Bestandteile von Trip-Hop, für welches Genre Portishead neben Massive Attack wie keine andere Band in den Neunziger- und Nullerjahren stand. Daher verwundert es wenig, dass Gibbons diese Tugend über die Jahre (und Jahrzehnte) hinweg verinnerlicht hat: „Beim Songwriting muss man etwas finden, an dem man stundenlang arbeiten kann. Denn sonst steht man nach zwei Wochen da und sagt: Das kann ich jetzt nicht mehr ertragen. Es hört sich absolut beschissen an“, wird sie im Text zum Album zitiert: „Und wenn man dann zehn verdammte Jahre hinter sich hat, weiß man, ob man es ertragen kann oder nicht.“
Zum Glück hat sie sich fürs Ertragen entschieden – und lässt uns daran teilhaben: nicht nur an einem auf faszinierende Weise gleichzeitig nach wenig und viel anhörendem Endergebnis, sondern auch an einem wahrlich mehr als zähen Produktionsprozess, indem sie vom immens langsamen Wachsen und Tüfteln an diesen zehn Songs erzählt, die auch tief in ihr Inneres blicken lassen, in Phasen von Abschied, Trauer, Ängsten, Mutterschaft und Wechseljahren.
Tupperware & Paella-Schüsseln
Stete Begleiter bei all diesem Ringen um Ausdruck – und vor allem um den adäquat & richtig klingenden Ausdruck – waren der ehemalige Talk Talk-Drummer Lee Harris und – etwas später hinzugekommen – Produzent James Ford (Arctic Monkeys), der auch einen Gutteil der Instrumente auf „Lives Outgrown“ selbst spielt, wenn man die Gerätschaften, die Gibbons dafür heranzog, überhaupt so nennen mag. Als buchstäbliches Schlag-zeug dienten etwa u.a. Tupperware (mit Erbsen gefüllt), Paella-Schüsseln, Wasserflaschen aus Kuhfell oder Teile eines Mischpults – alles, um von klassischen Breakbeats wegzukommen.
Weiters wurden von der zumindest eigenwillig zu nennenden Künstlerin eine Laute, ein Hackbrett und ein Ding herangekarrt, „von dem niemand weiß, wie es heißt“, erzählt James Ford, „das ein bisschen wie ein Kontrabass klingt, aber wie eine Ukulele ohne Bünde und mit dicken Gummisaiten aussieht und ein Albtraum ist, um es richtig zu spielen“. Nicht die einzige Herausforderung für den mehr als willigen Produzenten & Musikanten: Für den Eröffnungssong, „Tell Me Who You Are Today“, ist er sogar ins Innere eines Klaviers hineingekrochen, um dort die Saiten mit Löffeln anzuschlagen.
Nicht, dass man diese Kinkerlitzchen alle so überdeutlich und dezidiert heraushörte (selbst bei bester Wiedergabequalität nicht), trotzdem schafft dieses Sammelsurium einen ganz speziellen Klangraum, den man so nur selten hört – und teilhaftig betritt. Und damit wird auf gewisse, übergeordnete Weise eine weitere Portishead-Tradition fortgesetzt. Denn so wie im Trip-Hop ja auch nicht die Stimme das wesentliche Element war/ist (und sie ist es auch hier nicht, bei aller vordergründigen Präsenz), sondern verschleppte Rhythmen, verzögerte Tempi, die für eine somnambule Stimmung sorgen, für ein halluzinierendes Schwanken und Schweben, so sind es hier – als Fortsetzung mit anderen Mitteln – dezent veränderte Klangeigenschaften von (Quasi-)Instrumenten, die einen durchwegs eigenartigen und doch irgendwie vertrauten Sound generieren, „holziger“, naturnäher, bukolisch verfeinert & raffiniert, statt urban verdrogt oder artifiziell verfremdet.
Ein PJ-Harvey-Album des Jahres

Beth Gibbons hat einen naturnahen, „holzigen“ Sound generiert. Foto: Eva Vermandel
In diesem Sinne ist auch „Floating On A Moment“, der zweite Song der Platte, eine Art Zentralstück, getragen von einem ruhigen, harmonischen Fließen, und von einem – trotz aller stets mitschwingenden Bedrohlichkeit – letztlich unerschütterlichen Vertrauen ins Fallenlassen und – noch wichtiger – Aufgefangenwerden: „I’m floating on a moment / Don’t know how long/ No one knows/ No one can stay/ All going to nowhere/ All going …“
„Reaching Out“ (Nr. 6) ist das einzige flottere, pathetisch aufmunitionierte (und darin mit St. Vincents Bond-Song „Violent Times“ vergleichbare und korrespondierende) Stück, während „Whispering Love“ (Nr. 10) – mit Flöten und einem an Midlake erinnernden Klangbild (in das wiederum das Quietschen wie von einer leiernden Hutsche als irritierendes Element eingewoben ist) samt zarten Vogelstimmen & Hühnergegacker – in ein in jeder Hinsicht ruhiges & beruhigendes Fade Out hinausgleitet.
James Ford und Lee Harris, diese beiden treuen Gesellen, die viel zum Gelingen dieses exquisiten Albums beitragen, sind für Beth Gibbons ähnlich verlässliche Stützen wie John Parish und Mick Harvey für PJ Harvey, an welche (Kombi) das feinsinnige Gesamtpaket von „Lives Outgrown“ irgendwie frappant erinnert. Wenn man so will, könnte man es (auch) ein PJ-Harvey-Album des Jahres nennen (denn es ist höchst unwahrscheinlich, dass von dieser heuer noch ein solches erscheinen wird).

St. Vincent: All Born Screaming (Virgin)
„Beim Songwriting muss man etwas finden, an dem man stundenlang arbeiten kann. Denn sonst steht man nach zwei Wochen da und sagt: Das kann ich jetzt nicht mehr ertragen." (Beth Gibbons)